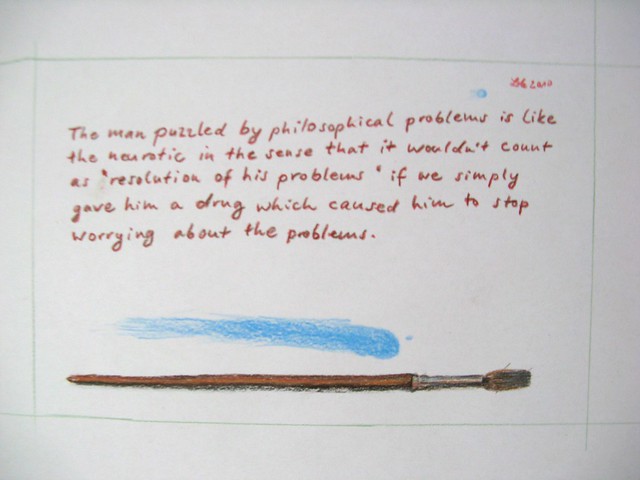„It is not the case, I think, that all kinds of nonsense have been adequately classified yet.“
(Austin, Performative utterances. In ders., Philosophical Papers)
Man redet auf verschiedene Weise darüber, was Dinge tun. Auf manche Weise redet man aber auch nicht. Unterscheide z.B.:
Das Messer schneidet das Gemüse gut.
Ich schneide das Gemüse mit Hilfe dieses Messers.
Meine Freundin schneidet das Gemüse.
Ich schneide das Gemüse mit (der) Hilfe meines Freundes.
Das „der“ ist hier offenbar ganz entscheidend. Man kann aber durchaus „mit Hilfe“ auf Menschen anwenden, wenn man Mittelsleute (sozusagen im Idealfall willenlose menschliche Hilfsmittel) einsetzt:
Mit Hilfe eines Mittelsmannes verschob er das Geld auf die Bahamas.
Aber zurück zum Eingangsbeispiel: Wie schneidet denn ein Messer? Gut, sauber, glatt etc., aber nicht gewissenhaft, geschickt, absichtlich:
Ich habe mir in den Finger geschnitten – Absichtlich oder unabsichtlich?
Das Messer hat mir in den Finger geschnitten.
Grenzfälle:
Der Computer erinnert mich („automatisch“ – wofür spricht dieses Adverb?) an den Geburtstag meines Freundes.
Die Maschine schneidet wenn nötig selbstständig den Faden ab.
* * *
Ein Auto erlaubt es mir, schnell auch weiter entfernte Ziele zu erreichen.
Mein Chef erlaubt mir, dieses Geld für einen neuen Computer auszugeben.
Darfst du das? – Mein Auto hat es mir erlaubt!
Heißt erlauben nicht einfach: ermöglichen? Aber wann verwendet man: „mein Auto ermöglicht mir“, „mein Chef ermöglicht mir“? Eine Person kann zwar durch ihre Erlaubnis etwas ermöglichen, aber häufig wird man eine substanzielle Unterstützung erwarten, wenn diese Formulierung benutzt wird. Meine Eltern hätten mir, als ich früher bei ihnen auf dem Dorf wohnte und noch keinen Führerschein hatte, erlauben können, bis um drei auf irgendwelche Partys in einer vierzig Kilometer entfernten Stadt zu gehen, aber sie haben es halt nicht ermöglicht (ein Auto hätte es ermöglicht, oder eine gute Busverbindung).
Aber man setze statt „erlauben“ ein: „die Erlaubnis erteilen“:
Mein Chef erlaubt mir (erteilt mir die Erlaubnis)… Mein Auto erlaubt…
Manchmal ermöglichen oder erlauben Menschen schon fast so wie Dinge:
Mein privater Koch ermöglicht (erlaubt) es mir, auf Wunsch Tag und Nacht kleine Mahlzeiten zu mir zu nehmen.
Der Koch erlaubt nicht im Sinne von „die Erlaubnis“ erteilen, sondern er ermöglicht nur. Umgekehrt erlauben Dinge fast wie Menschen:
Das Programm erlaubt keinen Zugriff auf die Datei.
Man muss sich das nicht nur unbedingt so vorstellen, dass eine Person einmal eingestellt hat, dass der Zugriff möglich ist, sondern der Computer könnte einen komplizierten Algorithmus verwenden, der „entscheidet“, ob man zugreifen darf. Ab wann erlaubt denn der Algorithmus und nicht mehr derjenige, welcher das Zugriffsrecht eingestellt hat oder den Algorithmus programmiert (vor allem wenn es viele Programmierer gibt)? Würde ein Programmierer auch „erlauben“, wenn der Algorithmus ein Zufallsprogramm wäre? Oder würde man dann gar nicht mehr von „erlauben“ sprechen? Oder ist die Diskussion nicht Unsinn, ob der Algorithmus oder Personen dahinter „erlauben“, da man ja immerhin so spricht wie oben angegeben, dass nämlich das Programm erlaubt? Handlungen lassen sich in arbeitsteiligen Zusammenhängen auch unterschiedlich zuschreiben: Erlaubt der Türsteher oder der Besitzer des Clubs denn den Zutritt? Je nach Sachlage und Absicht der Beschreibung! Es sind ja die verschiedensten Konstellationen denkbar, wie die beiden untereinander ausmachen, wer Zutritt hat. Außerdem kann man „erlauben“ auf leicht verschiedene Art gebrauchen:
Der Club-Besitz erlaubt nicht, dass angetrunkene Personen hereingelassen werden.
Der Türsteher hat einer angetrunkenen Personen nicht den Zutritt erlaubt.
Wenn wiederum der Zugriff auf eine Datei erlaubt ist, ermöglicht das so manches, aber es kann sich auch um eine leere Erlaubnis handeln, die einem nichts bringt: Man weiß nichts mit der Datei anzufangen. Zwischen Erlauben und Ermöglichen gibt es keine eindeutige Entsprechung. „Möglich“ ist ja bereits sehr stark von den Vorannahmen abhängig, nicht absolut zu sehen (ob es z.B. „möglich“ ist, von soundso viel Euro im Monat zu leben, hängt ganz entscheidend ab, auf welches reale oder nur „mögliche“ Wirtschafts- und Sozialsystem und auf welche Bedürfnisse man sich bezieht). „Ermöglichen“ kann also heißen, dass etwas „nur“, „theoretisch“ möglich wird, was man vorher, gemessen an einem Maßstab, als unmöglich ansah (aber noch nicht wirklich real ist oder nicht ohne weitere Vorbedingungen herbeizuführen – in diesem Sinne „erlaubt“ die Ermöglichung letzten Endes noch nichts). Oder es kann heißen, dass man nun etwas nun ohne weitere Vorbedingungen erreichen kann, wenn man es will (und was real ist, ist logischerweise ohnehin immer auch möglich: Ab esse ad posse valet). Erlauben kann umgekehrt hinreichend sein fürs „wirkliche“ Ermöglichen, wenn sonst alle Bedingungen erfüllt sind (man kann ermöglichen, indem man erlaubt; etwas kann auch erlauben, indem man ermöglicht, aber nicht notwendig). Man kann also mangels klarer Abgrenzung nicht sagen, Dinge ermöglichten „eher“ als Personen, oder ermöglichen „nur“, während Personen auch erlaubten, wenn man „erlauben“ auch anders benutzt, mal im Sinne von „ermöglichen“, aber nicht deckungsgleich.
Aber wie erlaubt „man“ (ein Ding, ein Mensch) denn so, und wann kann man „eine Erlaubnis erteilen“ einsetzen? „Man“ erlaubt: großzügigerweise, nach einigem Überreden, durch Einbau eines Zusatzmoduls, usw.
* * *
Man ist einerseits versucht, bestimmte Redeweisen als „nur“ eine Redeweise zurückzuweisen (Dinge, die so handeln wie Menschen), andererseits können gleiche Redeweisen darauf hinweisen, dass verschiedene Dinge in einer bestimmten Weise vergleichbar sind. Das sind drei verschiedene Soziologien: Erstens eine metaphysische Polizei, welche die Bevölkerung zur eigenen Sicherheit darüber aufklärt, dass es bestimmte Dinge nach Meinung der Sicherheitsexperten nicht gibt und es gefährlich ist daran zu glauben, z.B. böse Geister, Wunderheilungen, Computer mit einem Eigenleben, und welche dann aufklärt, wie es zu diesem Irrglauben kommen konnte. Zweitens eine botanische Soziologie, welche durch entlegene Landstriche wandelt und alle kuriosen Wesen einsammelt, welche sich so darbieten, die skurrilsten Redeweisen, die kuriosesten Figuren, welche die Gedankenwelten bevölkern, eben die genannten Geister, beseelten Maschinen usw. Schließlich eine Soziologie, die Sprach- und Situationswitze liebt, weil sie scheinbar unpassende Beschreibungen liefert oder Dinge vermeintlich falsch einordnet, Kategorienfehler begeht, worauf ja viele Witze beruhen, die so aber überraschende Betrachtungsweisen, Vergleiche und Beschreibungen liefert: Man kann x auch als y sehen oder beschreiben (Dinge tun dann etwas, was sie eigentlich nicht tun, aber es leuchtet ein, dass ihr Tun so ähnlich ist wie das von Menschen: Der Poller „verbietet“ das Parken so ähnlich wie eine gerade vor Ort verbindliche Polizistin oder ein Schild, ja sogar effektiver, aber eben doch anders). Diese Soziologien schließen sich ja offensichtlich nicht aus: Man kann fremde Vorstellungen sammeln und eigene hegen, vorhandene Beschreibungen analysieren, erklären und/oder kritisieren oder neue schaffen.
* * *
Selbst das inhaltsleere, von manchen als Unwort verschrieene „machen“ differenziert sehr fein nach Personen, Dingen und Teilen von Personen, und welche Dinge sie machen und welche nicht. Vergleiche etwa:
Die Flöte macht so ein Geräusch (z.B. wenn man falsch reinbläst, wenn man sie fallenlässt).
Die Lüftung macht so ein Geräusch.
Er macht so ein Geräusch mit dem Mund.
(In welchen Fällen würde man wohl sagen: „Sein Mund macht so ein Geräusch“?).
Der DVD-Player macht nicht, was ich will.
Die Pfanne macht eine gute Kruste, wenn man etwas darin anbrät.
Die Pfanne macht gerade ein Fischcurry.
Selbst „machen“ kann zwei Bedeutungen haben, die einer grundsätzlichen Möglichkeit (siehe bereits den vorletzten Satz) oder einer aktuellen Tätigkeit. Auf die Aussage, dass eine bestimmte Droge abhängig macht, kann man z.B. spitzfindig antworten: Nicht, wenn man sie nicht einnimmt. Das kann man wiederum zurückweisen mit dem Hinweis, dass die Droge eben so sei, dass sie abhängig mache, das sei ihre Eigenart, die sich zwar an jedem Fall neu erweise, aber unabhängig davon sei, dass es gerade jemand „ausprobiert“ (oder wie auch immer man die Aktivität einer Person und einer Droge beschreiben will, welche dazu führt, dass die Person abhängig wird).
* * *
Manchmal wird scheinbar auch das Produkt aktiv, erschafft sich selbst:
Ein trüber Film hat sich auf den Gläsern abgesetzt.
In den letzten Tagen ist eine Inversionswetterlage entstanden.
Das Kunstwerk entstand 1723.
Der Text schreibt sich (wie) von selbst.
Dieses „wie“ verweist darauf, dass wir manchmal keine Probleme damit haben, Formulierungen zu verwenden, welche eine Erschaffung aus dem Nichts andeuten, manchmal aber skeptisch sind. Eigentlich bei näherem Nachdenken meist: Die Ablagerung ist ja irgendwo hergekommen. Das herauszufinden ist ja oft gerade der Zweck des Geredes. Mal kann man aus Redeweisen etwas über die ontologischen Überzeugungen der Sprechenden herausfinden (es gibt Inversionswetterlagen, oder zumindest Dinge, die man mit diesem Wort grob zusammenfasst), mal sind es eben nur Redeweisen unter anderen (das Kunstwerk „entstand“ z.B., weil man schon so oft vom Künstler geredet hat, dass man seinen Namen nicht wiederholen will, oder man kennt ihn umgekehrt gar nicht).
Das „sich“ ist aber vielfach nur noch ein schwacher Abglanz einer wirklich selbstbezogenen Aktivität. Man wäscht sich die Hände, der Backofen reinigt sich selbst. Aber: Die Blätter verfärben sich im Herbst. Und eben: Ein trüber Film setzt sich ab. Hier geht es darum, dass Dinge in einem Zustand verharren oder ihn ändern (oft ohne dass eine besondere Aufmerksamkeit auf äußeren Einflüssen liegt, oder man findet diese insgesamt unbedeutend. Jedenfalls sind es die betreffenden Dinge „selbst“ – aber welche sonst? –, manchmal „von selbst“). Ersetzt man die wirklich reflexiven Formulierungen, taucht tendenziell immer noch ein Verweis auf den Akteur auf: Man wäscht seine Hände. Bei den praktisch bedeutungsneutral verwendeten reflexiven Sprachformen lässt sich dieser Verweis eher eliminieren: Die Blätter werden braun, nehmen eine rote Farbe an, wechseln die Farbe, usw. Man kann von der reflexiven Formen sogar in eine passive wechseln: Sie zersetzen sich oder werden zersetzt. Aber nicht: Ich werde von mir gewaschen.
* * *
Was wiederum eine Person macht:
Sie schneidet das Gemüse.
Sie schneidet es mit einem Messer.
Sie schneidet es mit der Hand.
Aber nicht mit dem Kopf, dem Herzen, der Lunge, die beim Schneiden mit dem Messer ebenso unabdingbar sind wie die Hand – das mag aber darauf hindeuten, dass der Ausdruck „mit der Hand“ ähnlich funktioniert wie „mit dem Messer“, nämlich dass es nicht um beliebige Voraussetzungen geht, sondern um verschiedene Varianten derselben Tätigkeit (mit der Hand, dem Messer, einer Maschine usw.). Ähnlich, aber auf ganz anderer Ebene: „mit voller Konzentration“, oder eben nicht – auch hier sind verschiedene Varianten denkbar. „Kopflos“ geht vielleicht auch, aber ohne Kopf kann eine Person nach Stand der Erkenntnis nicht schneiden.
Wir wissen, dass ein Messer Gemüse schneidet, aber dass eine Hand kein Gemüse schneidet – wie aber dann eine Person? Entweder schließt 1. die Person das Messer und die Hand ein, so dass alles zusammen das Gemüse schneidet (das wäre aber seltsam), oder 2. Hand und Person sind verschiedene Dinge (auch seltsam), oder 3. „schneiden“ bedeutet Verschiedenes, was einmal auf „die Person“ zutrifft (was bedeutet das aber?), einmal auf ein Messer, aber nicht auf eine Hand. Also kann „schneiden“ 1. einen Gesamtkomplex- und Prozess bezeichnen, welcher z.B. durch Körper plus Messer plus Schneidbrett plus Personalität plus… (und noch auf verschiedene andere Arten) sich manifestieren kann, oder 2. einen besonders zentralen Ausschnitt daraus, nämlich das Sicht-Auftrennen des Schneidguts am Messer. Weniger emblematische Ausschnitte des Ganzen werden seltener so bezeichnet (man schneidet mit der Hand, aber die Hand schneidet nicht), aber ferner auch analoge Vorgänge, welche durch Maschinen ausgeführt werden.
Hände tun überhaupt recht besondere Dinge. Sie spülen in der Regel nicht Geschirr oder fahren Auto, schreiben keine Texte. Sie zittern, und selten tun sie Dinge, zu denen Adverbien wie „gefühlvoll“ passen. Z.B.: A.s Hand strich B. durchs Haar, oder: Eine Hand kam durch den Türspalt und tastete nach dem Lichtschalter. (Wo findet man wohl solche Beschreibungen und welchen Zwecken dienen sie?)
* * *
Man sagt, Werkzeuge seien Verlängerungen oder Verstärkungen von Körperteilen. Ein Stock kann durchaus eine Art verlängerter Arm plus Hand plus Finger sein (meine Oma benutzt gerne einen Stock, um das sonst nur mühevoll erreichbare Radio ein- und auszuschalten). Wovon ist aber ein Schraubendreher eine Verlängerung? Was am Körper vollbringt nur annähernd dasselbe? Wie sehr Technik mit menschlichem Handeln vergleichbar ist, hat auch nicht unbedingt etwas mit der Komplexität oder Neuheit der Technik zu tun. Man vergleiche in dieser Hinsicht Roboter, Raketen, Computer, Atombomben, Glühbirnen, Feuerzeuge, Surfbretter, Hämmer, Pinsel, Notizzettel.
* * *
Wir haben uns womöglich in der Soziologie zu sehr darauf konzentriert, nur zwischen unbewusstem, sinnfreiem, unwillkürlichem etc. Verhalten und bewusster, geplanter, sinnhafter etc. Handlung von Menschen zu unterscheiden, und zu wenig die Fülle der Geschehnisse beachtet, die insgesamt rund um, durch, mit Hilfe von etc. Menschen und Dingen passieren. Wenn Bruno Latour das Verdienst zukommt, auf das „Handeln“ oder das Handeln (ohne Anführungszeichen) von Dingen hingewiesen zu haben, dann um den Preis sprachanalytischer Naivität, die er womöglich seinen beschriebenen Akteuren unterstellt: Die Leute glauben teilweise in der Tat, dass die Jungfrau Maria dieses oder jenes tut oder geschehen lässt, aber nicht unbedingt, dass ein Auto in derselben Weise etwas „erlaubt“ wie Vorgesetzte oder Eltern, und so für viele andere Fälle, wo die Bezeichnungen für Geschehen und Geschehenlassen bzw. Geschehenmachen gleich klingen, wenn Menschen oder Dinge daran beteiligt sind. Herauszufinden wäre, wie Leute das bei Computern, Primaten oder Spermien sehen.
Es gibt die Furcht vor der Mensch-Maschine, dass entweder der Mensch nur eine Maschine sei (de La Mettrie schrieb vom homme machine), dass er zur Maschine gemacht werde oder dass eine Maschine werden könne wie ein Mensch (oder zumindest der Mensch sogar durch eine recht menschenunähnliche Maschine ersetzt werden könne). Aber wir vergessen darüber den Wunsch, Dinge so zu tun wie Maschinen: sich bestimmte Dinge unfehlbar zu merken, im Sport präziser oder unermüdlich sich zu bewegen (aber der Reiz wäre sofort weg, gelänge das perfekt), „gestählt“ zu sein gegen Krankheiten und Gebrechen.
Wir stellen uns Maschinen vielfach als einen Ersatz für menschliche Arbeitskraft vor, was ja seit Jahrhunderten diskutiert wird, und das nicht zu unrecht. Aber Maschinen sind nicht nur Arbeitsmaschinen, sondern auch Wunschmaschinen: Sie vollbringen Dinge, die man ohne sie nicht könnte, erfüllen unerfüllbare Wünsche oder bewirken etwas, von dem man noch gar nicht ahnte, dass es einem gefallen könnte. Ein paar bewusst harmlose Beispiele – vergleiche:
Diese Kaffeemaschine macht einen so guten Kaffee wie meine Oma.
(Den die Oma ohne oder mit einer viel einfacheren Maschine macht.)
Diese Maschine macht einen traumhaften Kaffee, den bekäme man anders gar nicht hin.
Diese Maschine macht einen so guten Kaffee – ich wusste gar nicht, dass mir Kaffee so gut schmecken kann.
Aber viele Vorstellungswelten bestehen aus mehr als aus Menschen und Maschinen (bzw. eigentlich: Mensch und Natur). In der Tat eine schwierige und womöglich – zumindest für manche Zwecke – unsinnige Unterscheidung. Bzw. eine übermäßig verkürzte Formel für schwierige Entscheidungen: Ein Gott kann entweder handeln wie ein Mensch (nur etwas mehr von dieser oder jener Fähigkeit aufweisen), nur eine illusionäres Abziehbild menschlichen Handeln sein, oder umgekehrt der Mensch ein Ebenbild Gottes. Dinge können von einem Geist „bewohnt“ sein gleich dem menschlichen, oder Menschen nur eines der vielen Dinge sein, die von einem Geist „bewohnt“ sind wie eben alle Dinge, oder nichts davon. Hier sind wir wieder bei den oben unterschiedenen Soziologien, also wie man sich zu den Wesen verhält, die andere in der Welt und um die Welt herum sehen.
Und dann noch die Tiere. Man spricht davon, dass manche Leute Tiere vermenschlichen. Man kann entweder darauf antworten, dass wir das alle die ganze Zeit tun (zumindest indem wir von Tiere so reden wie von Menschen), dass das nur so scheint (die Redeweisen also trotz des gleichen Wortlauts nicht dasselbe meinen) oder dass überhaupt erstmal untersucht werden müsse, was wer für menschlich und für tierisch hält oder ob überhaupt alle so unterscheiden (denn man kann es auch anders formulieren – statt „vermenschlichen“: „keinen Unterschied machen“, „ganz andere Grenzen ziehen“ – solche Beschreibungen würden also die Unterscheidung nicht voraussetzen, sondern zum Gegenstand machen).
Der Hund erwartet sein Herrchen.
Der Hund erwartet sein Herrchen in drei Wochen zurück. (Man kann bezweifeln, dass das ein sinnvoller Satz sei.)
Der Hund tut so, als habe er Schmerzen im Bein.
(Tut er das auf dieselbe Weise wie ein Mensch? Kann man dieselben Adverbien einsetzen wie bei einem entsprechenden Satz über Menschen?)
* * *
Schließlich Darstellungen, bzw. was dargestellte Dinge tun, ja was sie überhaupt sind.
Der Mann auf dem Gemälde trägt einen goldenen Helm.
Das Bild zeigt einen Mann mit goldenem Helm.
(Beide vorstehenden Sätze würde man im Alltag, ja in einer kunsthistorischen Abhandlung als wahr in Betracht ziehen.)
Der goldene Helm glänzt im Kerzenlicht.
Den Helm gibt es wirklich. Er befand sich im Privatbesitz des Malers.
Du musst keine Angst haben, mein Kind, das ist nur ein Bild. Der Mann mit dem Helm tut dir nichts.
Der Maler hat sehr geschickt Glanzlichter auf dem Helm gesetzt.
(Die beiden vorigen Sätze sind eigentlich sehr kuriose Mischungen: Welcher Helm?! Trotzdem würden wir sie akzeptieren, so wie wir auch von einem „gemalten Helm“ reden würden.)
* * *
Man wird nun vielleicht fragen: Wie, kein Fazit? – Nun gut, wenn du willst:
Aus dem Vorstehenden ergibt sich…
Das Vorstehende führt uns zur Schlussfolgerung…
Ich ziehe aus dem Vorstehenden den Schluss…
Mein Bildschirm zeigt folgenden Schlussabsatz an…
Ich wurde von … [setze eine natürliche Person oder übernatürliche Entität ein] zu folgender Schlussfolgerung inspiriert…